1. Von SEO zu LLMs: Warum Vertrauen die neue Währung ist
Vor einigen Jahren war SEO in der Wahrnehmung vergleichsweise einfach. Ich erinnere mich gut an diese Zeit: Wer bei Google auf Platz 1 oder 2 stand, dem wurde automatisch Qualität zugeschrieben. Der Gedanke war simpel: Wenn Google dich oben listet, musst du gut sein. Heute wiederholt sich dieses Muster – nur in einer neuen Form. Wer in einem Large Language Model wie ChatGPT, Gemini oder Claude erwähnt wird, genießt heute eine ähnliche Vertrauensstellung. Eine AI-Antwort wirkt wie ein objektives Urteil, nicht wie Werbung.
Gaurav Vohra beschreibt in „SEO is Dead. Long Live GEO“ (2025), dass LLM-Traffic teils zwölfmal besser konvertiert als klassische Suche. Ahrefs etwa meldet: 0,5 % der Besucher über LLMs, aber über 12 % der Sign-ups. LLM-Sichtbarkeit wird damit zur neuen Währung für Markenvertrauen. Bei klassischer SEO sehe ich Quelle und Link, kann selbst prüfen, ob etwas stimmt. Bei LLM-Antworten nehmen viele das Ergebnis als Wahrheit hin, ohne zu hinterfragen, woher es kommt. Das ist gefährlich – nicht, weil AI lügt, sondern weil wir das Prüfen verlernen.
Einige Modelle wie Perplexity gehen hier weiter: Sie nennen Quellen offen. Das halte ich für essentiell, denn am Ende fassen LLMs nur Informationen zusammen, die anderswo entstanden sind. Wie verlässlich das Ergebnis ist, hängt davon ab, wie gut ich die Quelle kenne und wie kritisch ich sie bewerte.
Was nach Fortschritt klingt, birgt also Risiken. Wenn Erwähnung mit Wahrheit verwechselt wird, entstehen Vertrauensblasen. Ähnlich wie in den frühen Google-Tagen, nur schneller und weniger überprüfbar. Die Frage ist nicht, ob LLMs Marketing verändern, sondern wie wir Vertrauen bewahren, wenn es algorithmisch verteilt wird. Und was das für SEO, GEO und Markenführung bedeutet.
2. Wie ein LLM wirklich funktioniert
Ein Large Language Model funktioniert wie ein Satz-Vervollständiger. Es berechnet, welches Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit folgt. Stell dir einen Marketing-Satz vor: „Das Ziel von SEO ist es, mehr …“
Das Modell schaut auf Milliarden Beispiele und wählt das wahrscheinlichste Wort, etwa:
- Traffic
- Leads
- Performance
- Clicks
- GEO
Nicht, weil es versteht, was richtig ist, sondern weil es gelernt hat, was wahrscheinlich richtig klingt. LLMs sind keine Wissensspeicher, sondern Wahrscheinlichkeitsmaschinen. Sie zählen Worte, nicht Wahrheiten. Genau das, was viele als Schwäche sehen, kann in kreativen Prozessen ein Vorteil sein. Wo es nicht um exakte Fakten, sondern um neue Perspektiven geht, erlaubt diese Unschärfe, Gedankenexperimente durchzuspielen, auf die man selbst nicht gekommen wäre.
Wenn es jedoch auf Präzision ankommt, muss klar sein: Ein LLM verifiziert nicht, es generiert Wahrscheinlichkeiten. Darum verknüpfen wir bei hurra.com in OWAPro™ geprüfte Datenquellen mit validierten LLMs über MCP-Schnittstellen, damit Zahlen, Daten und Fakten auf Wahrheit beruhen, nicht auf Wahrscheinlichkeit.
Und genau hier liegt ein tieferes Problem, das über AI hinausgeht. Auch im Performance Marketing gilt: Nicht alles, was richtig aussieht, ist richtig. Ein Klick ist nicht immer ein echter Klick und nicht jeder Besucher ein Mensch. Genau deshalb haben wir AdsDefender entwickelt. Das System erkennt und filtert „ungefähr richtige“ Signale wie Fraudulent Clicks. Denn wenn falsche Signale in Kampagnen als valide Messwerte gelten, führen sie zu falschen Entscheidungen – genauso wie plausible, aber falsche LLM-Antworten.
3. Kritisches Denken ist wie ein Muskel – und warum AI ihn schwächen kann
Die Neue Zürcher Zeitung schrieb 2025: Häufige ChatGPT-Nutzung kann das kritische Denken messbar verringern (Quelle). Neurowissenschaftler Lutz Jäncke bringt es auf den Punkt: „Kritisch denken ist wie ein Muskel. Man muss ihn trainieren, sonst verlernt man ihn.“
Das erinnert mich an Sport. Wenn man sich ständig fahren lässt, verlernt man das Gehen. Und wenn man bei jeder Denkaufgabe sofort ChatGPT fragt, verlernt man, selbst zu denken. Ich versuche deshalb, erst selbst zu denken, bevor ich AI nutze. So verlockend bequem es ist, ChatGPT das Denken zu überlassen, es ist wie mit Süßigkeiten: kurz befriedigend, aber ungesund, wenn man sie zu oft isst.
Neulich habe ich Prompts getestet, bei denen ChatGPT bewusst Fehler einbaut. Ein gutes Training, um zu prüfen, ob man selbst aufmerksam bleibt. Entscheidend ist, zwei Fragen zu unterscheiden:
„Kann das sein?“ ist bequem.
„Macht das wirklich Sinn?“ verlangt Denken.
AI beschleunigt alles, auch Fehler. In einer Welt, in der alles schneller geht, wird kritisches Denken zur wertvollsten Ressource.
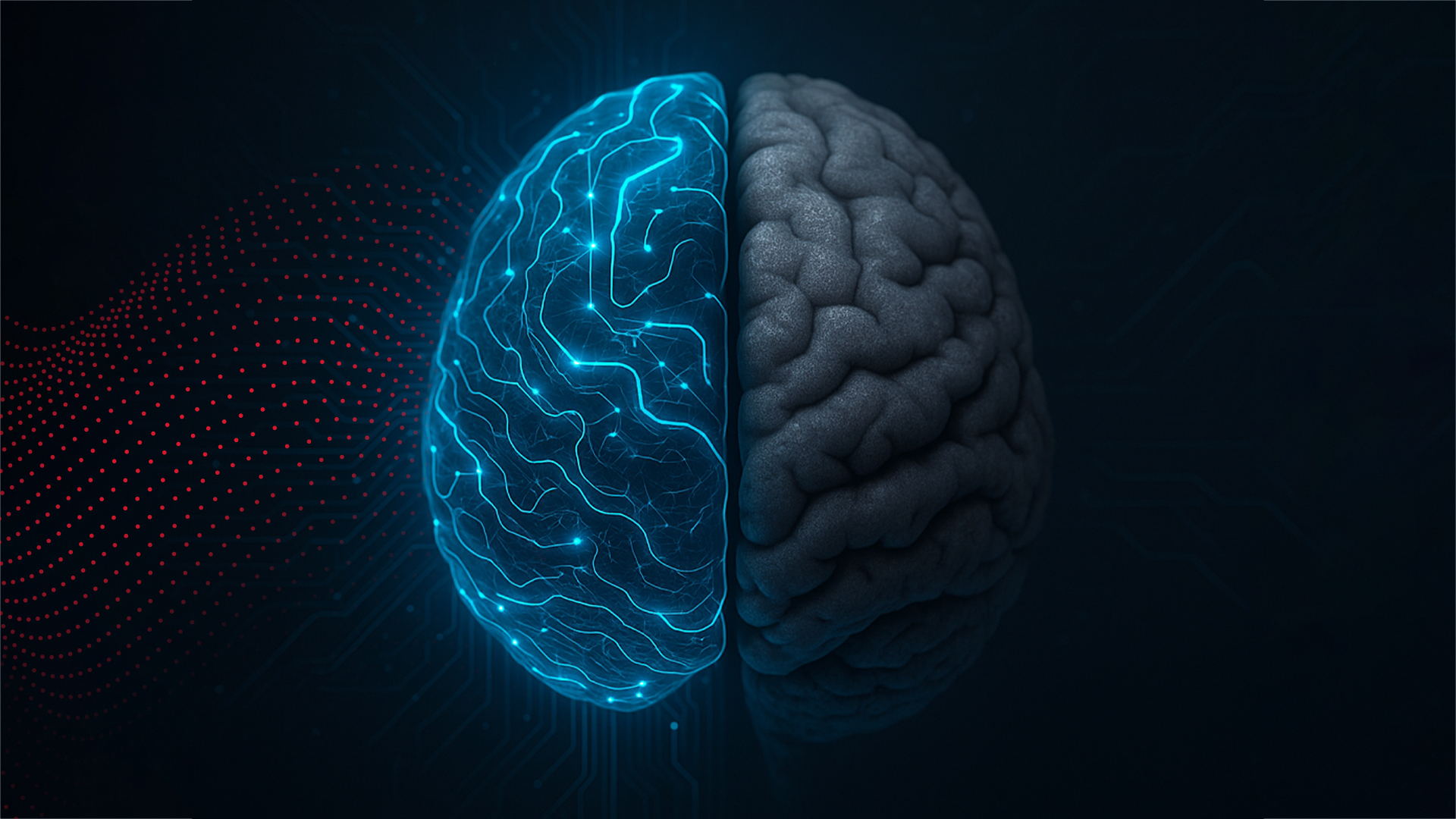
4. Wie Marken Kontrolle behalten: Daten, Content und Intelligenz
Sichtbarkeit allein genügt nicht mehr. Wichtig ist, zu verstehen, wie die eigene Marke wahrgenommen wird.
Deshalb haben wir bei hurra.com das LLM / GEO-Monitoring entwickelt. Es prüft fortlaufend, wie Marken in generativen Systemen wie ChatGPT, Perplexity oder Google AI Mode auftauchen:
- Wie oft wird die Marke genannt,
- in welchem Kontext,
- mit welchem Sentiment – positiv, neutral oder negativ.
So entsteht ein klares Bild, wie eine Marke in der neuen AI-Suchwelt wahrgenommen wird. Frühwarnsignale lassen sich erkennen, Reaktionen gezielt steuern. Das ist entscheidend, um Trust messbar zu machen. Diese Insights verknüpfen wir mit OWAPro™, unserer Business-Intelligence-Plattform. Sie führt alle Marketing- und Kostendaten in einer Single Source of Truth zusammen und stellt sicher, dass Fakten belastbar bleiben, auch in AI-Systemen.
Und dennoch gilt: Content is King.
AI kann skalieren, aber nicht authentisch erzählen. Marken, die eigene Inhalte schaffen – über Leistungen, Haltung und Ergebnisse – werden langfristig sichtbar und vertrauenswürdig bleiben. Gerade weil Paid Traffic teurer wird, ist Owned Content der nachhaltigste Weg zu Relevanz.
Fazit: Denken bleibt der Wettbewerbsvorteil
AI beschleunigt, aber sie denkt nicht. In einer Welt, in der vieles „ungefähr richtig“ klingt, gewinnen diejenigen, die fragen, prüfen, kreativ bleiben und verstehen.





